Mastodon
CC2.tv: Computerclub 2
|
|
|
|
|
|

Wohnung im Röntgenblick
Samstag, 2025-11-08 10:00, Eintrag von Wolfgang Rudolph

Mal ein ganz langer Text, den ich mir für die Moderationsvorbereitung geschrieben habe.
1) Warum WLAN mehr kann als Daten übertragen
WLAN-Netze messen bei jeder Paketübertragung ihren Funkkanal, um die Verbindung zu optimieren. Diese Messwerte lassen sich zweckentfremden: Aus den Veränderungen des Funksignals kann ein System Bewegungen, Präsenz und sogar grobe Topologieänderungen im Raum erkennen – ganz ohne Kamera oder zusätzliche Sender. Der Fachbegriff dafür lautet „WLAN Sensing“. Die Idee: Was die Luftschnittstelle ohnehin über den Zustand des Kanals verrät, wird nicht nur für die Wahl von Modulation, Codierung und Beamforming genutzt, sondern zusätzlich ausgewertet, um ein Abbild der Umgebung zu gewinnen. Der Ansatz ist unaufdringlich, funktioniert durch Wände und nutzt vorhandene Access Points. Damit entsteht eine sensorische Ebene über dem bestehenden Netz, die für Komfort, Sicherheit und Effizienz neue Anwendungen ermöglicht – vom Präsenz-Trigger im Smart Home bis zur anonymen Belegungsmessung in Gebäuden.
2) Physikalische Grundlage: OFDM, MIMO, Multipath
WLAN (ab 802.11a/g) nutzt OFDM: Das Gesamtspektrum wird in viele schmale Unterträger zerlegt, die parallel übertragen werden. Mehrantennensysteme (MIMO) senden/empfangen mehrere räumliche Datenströme gleichzeitig. In Innenräumen trifft jedes Signal über viele Wege ein (Multipath). Jeder Weg addiert sich vektoriell – mal konstruktiv, mal destruktiv – und verändert die Phase und Amplitude pro Unterträger. Bewegt sich ein Objekt, verschieben sich diese Interferenzen zeit- und frequenzabhängig; zusätzlich entstehen Doppler-Anteile. Genau diese winzigen Änderungen sind die Quelle für Sensing: Das Netz „sieht“ nicht das Objekt selbst, sondern dessen Einfluss auf den Funkkanal. Je breiter der Kanal und je größer die Antennenapertur, desto feiner lassen sich Wege unterscheiden und Richtungen schätzen.
3) Channel State Information (CSI) – das Messobjekt
Bei der Kanalschätzung bestimmt der Empfänger pro Unterträger und pro Antennenkombination einen komplexen Übertragungskoeffizienten (H(f)). Die Gesamtheit dieser Werte nennt man Channel State Information (CSI). CSI liegt als Matrix über Unterträger, räumliche Streams und Antennenpaare vor und wird bei jeder Übertragung aktualisiert. Access Points und Endgeräte nutzen CSI, um Modulation/Codierung (MCS), Sendeleistung, Beamforming und Kanalwahl anzupassen. Für Sensing wird dieselbe CSI gespeichert und zeitlich analysiert. Änderungen von Amplitude/Phase weisen auf Bewegungen, Topologieereignisse oder Präsenz hin. Wichtig: Sensing benötigt keine zusätzlichen Pilotsignale – es nutzt die ohnehin vorhandenen Pilottöne und Nutzpakete. Damit bleibt die Datenübertragung unbeeinflusst.
4) Signalverarbeitung: von Rohdaten zu Ereignissen
Eine typische Pipeline beginnt mit Kalibrierung (Gain/Phase), Korrektur von Trägerfrequenz- und Symboltaktfehlern, sowie Outlier-Filtern. Danach werden Amplituden- und Phasenverläufe pro Unterträger/Stream extrahiert und über die Zeit analysiert. Kurzzeit-Fourier-Transformationen liefern Doppler-Spektren; Array-Verfahren wie AoA/AoD schätzen Einfalls-/Abstrahlwinkel. Aus den Merkmalen – etwa RMS-Delay-Spread, Rician-K-Faktor, Dopplerpeaks, Koherenzzeit – entstehen Features für Klassifikatoren. Für Tracking eignen sich Kalman- oder Partikelfilter; für Erkennung sorgen Schwellen, Clustering oder ML-Modelle. Entscheidend ist die Stabilisierung gegen Temperatur-/Drift-Effekte, sowie die Fusion mehrerer AP-Sichten, damit aus lokalen Indizien robuste Ereignisse werden.
5) Hardware und Standards: ac/ax/be, MU-MIMO, 80/160 MHz
Moderne Netze nach 802.11ac/ax und perspektivisch 802.11be (Wi-Fi 7) stellen breite Kanäle (80/160 MHz) und MU-MIMO bereit. Breite erhöht die Delay-Auflösung, MIMO erweitert die räumliche Auflösung. Beamforming schafft gerichtete Pfade mit gut messbaren Korrelationen. Für Sensing genügen 2×2-Systeme, 4×4 oder 8×8 steigern die Qualität deutlich. Wichtig ist der CSI-Zugang: Manche Chips erlauben paketweises CSI-Export, andere nur Summenstatistiken. Für verteilte Szenarien lohnt eine Uhr-Disziplinierung (z. B. über PTP) zwischen APs, um Zeitbasen zu stabilisieren und Winkel-/Laufzeitmessungen sauber zu fusionieren.
6) Leistungskennzahlen und Auflösung
Die „Auflösung“ wird nicht als Zentimetermaß allein verstanden, sondern als Gesamtsystem-Leistung: Entdeckungswahrscheinlichkeit (P_d), Falschalarmrate (P_{fa}), Reichweite bei gegebener SNR, Latenz bis zur Erkennung und Genauigkeit von Richtung/Entfernung. Bandbreite verbessert die Delay-Diskriminierung, Antennenapertur/Winkelabstand verbessert AoA-Schätzungen, Paketdichte senkt die Latenz. In ruhigen Umgebungen ist Präsenzdetektion extrem zuverlässig; feine Gesten erfordern hohe Paketdichten und gute SNR. Für Personen-Zählung zählt die robust kombinierte Sicht vieler APs mehr als das Einzelgerät. Messkampagnen mit Ground-Truth (z. B. Lichtschranken, IMU-Logger) sind Pflicht, um ROC-Kurven zu erstellen und Schwellen sauber zu setzen.
7) Anwendungen: von Präsenz bis Gebäudeeffizienz
Im Smart Home schalten Präsenz-Trigger Licht/Heizung ohne Kameras. In Büros messen Systeme anonym die Belegung, optimieren Reinigung und Klima. In Logistik-/Industrieflächen erkennt Sensing Bewegungen in Sperrzonen, zählt Durchgänge oder triggert Forklift-Warnungen. Gesundheitsnahe Szenarien reichen von Sturzerkennung (nur als technischer Hinweis, keine Diagnose) bis zu Aktivitätsprofilen. In Retail-Flächen lassen sich Besucherströme grob erfassen, ohne personenbezogene Videos. Gebäudetechnik profitiert doppelt: Sensing liefert Lastprognosen für HVAC und verbessert WLAN-Selbstoptimierung – beides spart Energie. Wichtig bleibt, die Erkennungsziele klar zu definieren: Präsenz ja/nein, Anzahl, Bewegungsrichtung, Aufenthaltszonen – jede Zielgröße verlangt eine passende Feature- und Sensorfusion-Strategie.
8) Systemintegration und Geräte im Feld
Sensing benötigt keine Spezialgeräte – Smart-Home-Aktoren, Steckdosen, Thermostate, Sensor-Hubs wirken als zusätzliche „Messpunkte“, sofern ihr Treiber CSI oder geeignete Statistiken liefert. Auf AP-Seite sammeln Dienste die Rohdaten, normalisieren sie und verteilen sie an eine Auswerte-Engine. Für Edge-Betrieb bieten sich leichte Modelle an; für große Gebäude lohnt ein zentraler Inferenz-Server. API-Design ist entscheidend: Roh-CSI ist datenintensiv, daher sind vorverarbeitete Merkmale (z. B. Subträger-Energiebänder, Doppler-Bins) oft die bessere Austauschgröße. Für die Aktorik reicht ein einheitlicher Ereignis-Bus („presence.zoneA=true; confidence=0.93“) – angebunden an Hausautomation (z. B. KNX, MQTT, Home Assistant).
9) Datenschutz, Sicherheit, Ethik
WLAN Sensing arbeitet ohne Kamerabilder und kann datenarm sein, doch es bleibt ein Sensor. Gute Praxis: klare Zweckbindung (z. B. „Präsenz fürs Licht“), Datenminimierung (nur Events statt Roh-CSI speichern), lokale Auswertung, kurze Speicherfristen und transparente Nutzerinformation. Personenidentifikation ist nicht Ziel; Modelle sollten auf anonyme Zustandsgrößen trainiert sein. Sicherheit: Zugriff auf CSI und Sensing-API strickt authentifizieren, TLS erzwingen, Logs härten. In regulierten Umgebungen sind Betriebsvereinbarungen und Datenschutz-Folgenabschätzungen sinnvoll. Ethik bedeutet hier: Funktionen erklären, Opt-out anbieten, und falsche Sicherheit vermeiden – Sensing ist ein probabilistischer Detektor, kein Garant.
10) Grenzen, Tücken und Roadmap
Grenzen entstehen durch SNR, starke Störer, metallische Strukturen und sich ändernde Möbel. Systeme müssen regelmäßig re-kalibrieren und Drift erkennen. Falschalarm-Quellen (Ventilatoren, Vorhänge) lassen sich über Frequenz-Signaturen und Mehr-AP-Konsens dämpfen. Für kleine Gesten braucht man viele Pakete oder dedizierte Trainingsphasen. Roadmap: Wi-Fi 7 (802.11be) erhöht Paketdichte, Bandbreite und MLO-Robustheit; die Sensing-Spezifikation 802.11bf (in Arbeit) standardisiert Prozeduren/Interfaces. Kurzfristig lohnt die saubere Datenerfassung (CSI-Export), mittelfristig die Fusion mit anderen passiven Quellen (z. B. BLE-RSSI, Stromzähler), langfristig On-Device-Modelle mit Transfer-Learning, die sich an neue Räume anpassen, ohne Ground-Truth-Orgie.
Vielen Dank an die Spender:
Backemann
Robin ypid Schneider
Georg Kramer
Hund Bobby
OE5WZO
OGU
Katze Murka und Kater Rigik und Seiko
M1Molter
DG1FCB
Stephan Hege
Andreas Schell
Yogi
Rene Liebich
DG3BK
Bernd Hillert
Dritter Detektiv
Oliver Buhmann
RONNY RONALD SCHMIDT
Klaas Koch
Philipp Rozanek
Marcel Straube
Krümelkutsche
DL1MAZ
Der Michelstädter
MarcO F.
Die Sendung ist auf Youtube zu finden: https://youtu.be/HXtHwFFh3ng


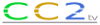
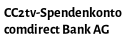
 DE09 2004 1111 0470 6628 00
DE09 2004 1111 0470 6628 00  COBADEHDXXX
COBADEHDXXX Wolfgang Werner Rudolph
Wolfgang Werner Rudolph Youtube, HD 1080p
Youtube, HD 1080p RSS-Feed der Videosendungen
RSS-Feed der Videosendungen Ogg Vorbis, 56 kBit/s (~18 MB)
Ogg Vorbis, 56 kBit/s (~18 MB) MP3, 128 kBit/s (~40 MB)
MP3, 128 kBit/s (~40 MB) MP3, 32 kBit/s (~12 MB)
MP3, 32 kBit/s (~12 MB) RSS-Feed der Audiosendungen
RSS-Feed der Audiosendungen

